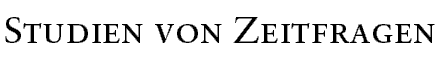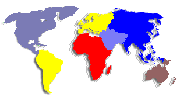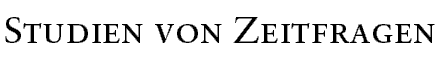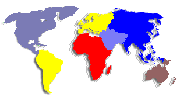Neuer Atlantizismus oder neues Atlantis?
Nachfragen zum deutsch-amerikanischen Verhältnis
von Peter G. Spengler
Mythen haben ihre Schicksale. Im Timaios läßt Platon den Kritias erzählen, was der ägyptische Priester von Saïs Solon über die vorzeitlichen Ursprünge Athens und seine Behauptung gegen die Unterjochung durch die mächtige Herrschaft des Inselreichs
Atlantis zu offenbaren hatte. Der Priester zu Solon: »Unsere Bücher erzählen nämlich, eine wie gewaltige Kriegsmacht einst euer Staat gebrochen hat, als sie übermütig gegen ganz Europa und Asien zugleich vom atlantischen Meer heranzog. ... Indem sich nun diese ganze Macht zu einer Heeresmasse vereinigte, unternahm sie es, unser und euer Land und überhaupt das ganze innerhalb der Mündung liegende Gebiet mit
einem Zuge zu unterjochen. Da wurde nun, mein Solon, die Macht eures Staates in ihrer (vollen) Trefflichkeit und Stärke vor allen Menschen offenbar. Denn vor allen Andern an Mut und Kriegskünsten hervorragend, führte derselbe zuerst die Hellenen, dann aber ward er durch den Abfall der Anderen gezwungen, sich auf sich allein zu verlassen, und als er so in die äußerste Gefahr gekommen, da überwand er die Andringenden und stellte Siegeszeichen auf und verhinderte so die Unterjochung der noch
nicht Unterjochten und gab den Andern von uns, die wir innerhalb der herakleischen Grenzen wohnten, mit edlem Sinne die Freiheit zurück. Späterhin aber entstanden gewaltige Erdbeben und Überschwemmungen, und da versank während eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht das ganze streitbare Geschlecht bei euch scharenweise unter die Erde, und ebenso verschwand die Insel Atlantis, indem sie im Meer unterging.«
Schicksale haben auch ihre Mythen. Der Koordinator für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt, Karsten Voigt  , hielt bei der Einweihung des Center for
German and European Studies an der Universität von Wisconsin in Madison am 30. September 1999 eine Rede, die man auch als eine Beschreibung von Atlantis lesen könnte: , hielt bei der Einweihung des Center for
German and European Studies an der Universität von Wisconsin in Madison am 30. September 1999 eine Rede, die man auch als eine Beschreibung von Atlantis lesen könnte: »Europa und Amerika haben im vergangenen Jahrzehnt sowohl sich selbst als auch ihre jeweilige Stellung im internationalen System stark verändert. Die USA sind die einzig verbliebene Weltmacht und haben erstmals in der Geschichte keine ebenbürtigen Gegner. Sie sind weltweit der einzige Staat, der zu
dauerhafter globaler Projektion militärischer Macht in der Lage ist. Sie besitzen die leistungsfähigste Volkswirtschaft der Erde. Nur die Vereinigten Staaten sind in der Lage, eigene Normen und Standards (aktuellstes Beispiel ist das Internet) weltweit durchzusetzen. Kulturell besteht bei vielen Europäern das alte Überlegenheitsgefühl gegenüber den USA zwar fort, berechtigt ist es aber schon lange nicht mehr. Nicht nur für die Massengesellschaft setzen die USA seit langem weltweit die
Maßstäbe. Auch bei Forschung und Lehre, im Film oder in der zeitgenössischen Kunst dominieren sie. Ihre globale Rolle begründet sich auf einer historisch einmaligen Synthese von wirtschaftlicher Stärke, weltweiter kultureller Meinungsführerschaft und militärischer Überlegenheit. Im amerikanischen Selbstgefühl gibt es derzeit weniger Grund denn je, andere Maßstäbe als die eigenen zur Richtschnur weltweiten Handelns zu nehmen.«
So ganz ausgemacht und klar will es nun doch nicht scheinen, ob diese Selbstgewißheit einer »amerikanischen Meinungsführerschaft« auch schon ein amerikanisches Selbstgefühl ist. Keiner aber kann diesen Gefühlsüberschwang über die »einzige Weltmacht« kerniger ausdrücken als der stets von Welt- und Geopolitik benebelte ehemalige Sicherheitsberater des Präsidenten Carter, Zbigniew Brzezinski. Der schrieb englischen Klartext in National Interest (Sommer 2000): »... Currently, Europe--despite its economic strength, significant
economic and financial integration, and the enduring authenticity of the transatlantic friendship--is a de facto military protectorate of the United States. This situation necessarily generates tensions and resentments, especially since the direct threat to Europe that made such dependence somewhat palatable has obviously waned. Nonetheless, it is not only a fact that the alliance between America and Europe is unequal, but it is also
true that the existing asymmetry in power between the two is likely to widen even further in America's favor.«
Man sieht, Brzezinski läßt sich kaum von Mythen verführen, dafür aber um so leichter von einem gelinden Machtwahn, dessen Ausleben im Generalstabssandkasten mit Zinnsoldaten und gewaltigen Flugzeugträgern man sich als seine wöchentliche Spielübung mühelos vorstellen kann; er hat es ja auch schon mal als nicht gewählter Amtsträger vor zwanzig
Jahren ausprobiert. Woher er die Aphrodisiaka zu diesem geopolitischen Spielrausch herhat, ist nicht so schwer ausfindig zu machen. Die nostalgischen Weltvorstellungen, die dieser Kleinadlige aus seinem Heimatwinkel unweit des »eurasischen Herzlandes« nach Amerika mitgebracht hat, werden aufs Ausführlichste und intim entfaltet und ausgebreitet in Caroll Quigleys »The Anglo-American Establishment«. Dort kann man die »dunkle Seite der Macht« kennen- und Brzezinski als den
ideologischen Wiedergänger von Darth Vader verstehen lernen. Muß nun das bis zur Selbstverzettelung und -verzwergung föderalisierte und regionalisierte Europa, das in so vielem dem Zustand der amerikanischen Staaten zwischen Sieg im Unabhängigkeitskrieg und unverzagten Versuch der Gründerväter, diesem losen Gebilde der Freiheit eine Verfassung zu geben, ähnelt, sich vor der neu zur Macht antretenden amerikanischen Regierung fürchten? Muß
Deutschland besorgt sein um das Verhältnis zu einer kommenden Präsidentschaft, deren wichtigstes Personal schon einmal vor etwa zehn Jahren die »Neue Weltordnung« in Angriff genommen und vor allem durch Angriff herzustellen versucht hat? Könnte es geschehen, daß die europäischen Mitglieder der NATO, wenn man ihre im letzten Jahr beschlossene Neuausrichtung mit neuen nicht mehr defensiven, sondern interventionistischen Aufgaben bedenkt, auch wieder in einen
»Krieg nach Gefühl« (Dieter S. Lutz) mitgerissen werden, dessen fragwürdige Gründe dann ein Jahr danach eine Parlamentarierversammlung aufarbeiten darf? Muß die Freiheit »innerhalb der herakleischen Grenzen« Frontstellung gegen Atlantis einnehmen?
Die Antworten geben wir selbst
Gewiß nicht in Deutschland. Denn dieses Land ist wie kein
anderes in Europa dazu fähig geworden, alles, was vom Atlantik herüber aus den Vereinigten Staaten an Zumutungen in der alten Welt anlandet, als Strandgut einer oftmals lästigen »irrational exuberance« nachsichtig und freimütig zu prüfen und auf seine Beförderung der Grundsätze und der Zwecke hin wahrzunehmen, die das deutsche Grundgesetz und die Verfassung der Vereinigten Staaten seit 1948 gemeinsam haben. Im Zeitalter nach Beendigung des kalten Krieges ist
dieses Verhältnis die einzige und mächtige legitime Quelle der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Auch der Koordinator dieser Freundschaft scheint das ähnlich zu sehen: »Innerhalb Europas haben sich auch Selbstverständnis und Rolle Deutschlands geändert. Heute ist das vereinigte Deutschland ausschließlich von Freunden umgeben und fühlt sich aktuell nicht mehr von außen bedroht. Seine Streitkräfte sind drastisch
reduziert, die auf seinem Territorium stationierten fremden Truppen ganz oder überwiegend abgezogen. Deutschland braucht auf absehbare Zeit die transatlantische Partnerschaft nicht mehr, um sich, wie früher, vor äußerer Bedrohung zu schützen. Statt dessen braucht es sie, um gemeinsam mit den USA Demokratie, Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand in ganz Europa, auch über die gegenwärtigen Grenzen von NATO und EU hinaus, zu sichern. Anders ausgedrückt: Deutschland ist nicht mehr
Konsument, sondern Produzent von Stabilität und Sicherheit in Europa.«
Diese Feststellung ist gerade zu Anfang des Jahres 2001 und zu einer neuen Präsidentschaft nicht trivial. Auch deswegen nicht, weil sich jetzt schon aus London ein nicht zu überhörendes Mäkeln an zwei wichtigen Ernennungen in Washington vernehmen läßt. Der neuernannte Außenminister wird so eingeschätzt: »The general opposed the idea of a Gulf war. When Saddam
Hussein invaded Kuwait, he argued against a military response, telling Dick Cheney, then secretary of defence, ›We can’t make a case for losing lives in Kuwait.‹ When President George Bush decided to confront the Iraqis anyway, General Powell argued in favour of a tough regime of sanctions, not an invasion. And when the Iraqis were driven out of their conquered territory, the general was in favour of ending the war immediately.
General Powell is no isolationist, someone who thinks American
troops should be used only in the case of an attack on the American mainland. He accepted that American interests were at stake in the Gulf. He opposed the war not on principle but for fear of casualties: he had been presented with estimates that ran high as 40,000. Still, his hypercautious reluctance to send troops into danger led him at that time to take a position no different from isolationists in practice, though different in principle.«
Allerhand: Hier wird der einzige »Befehlshaber« der Regierung George Bush I, der bei der Beratung von Gegenmaßnahmen gegen die Besetzung Kuweits durch die Truppen Saddam Husseins vor zehn Jahren Klarheit im Denken, wenn auch nicht im Handeln bewiesen hat, beinahe als »Isolationist« entlarvt. Aus britisch-atlantischer Sicht ist dies ein gewichtiger Vorhalt, der eine peinliche Beobachtung des Amtsaspiranten zwingend nahelegt.
Die angeführten Bemerkungen zu Colin Powell sind nicht etwa altersmilde, mandelbittere Bemerkungen von Margaret Thatcher, die zwar ihre Handtasche beiseitegelegt hat, aber doch sich ein paar späte Bemerkungen über »wets« nicht verkneifen kann, sondern sie stehen am 23. Dezember in einem Leitartikel des Economist, der sich in dieser Ausgabe auch seiner breiten Leserschaft in den Vereinigten Staaten rühmt. Das Zitat des Leaders aus dem Economist faßt zwar
Erkenntnisse zusammen, die man beispielsweise Bob Woodwards »The Commanders« vom Jahre 1991 entnehmen kann, aber die Intelligenz des Economist-Lesers in den USA oder sonstwo wäre unterfordert, wenn er seine Erkenntnisse nicht zum Beispiel noch aus zwei anderen Büchern ziehen würde, die, zum gesamten Lagebild hinzugenommen, sehr viel Aufschluß über Entstehung und Austragung eines Krieges geben, der bis heute als Schwelbrand fortdauert und von den
Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich immer mehr in die Verlustzone hineingeflogen wird. Gemeint sind die Reportagen Pierre Salingers, nachzulesen in »Pierre Salinger and Eric Laurent, Secret Dossier: The Hidden Agenda Behind the Gulf War, New York 1991« und Ramsey Clarks 1992 veröffentlichte Untersuchung und Chronik von Operation »Desert Shield« und »Desert Storm« unter dem Titel »The Fire this Time« (Deutsch »Wüstensturm«, Göttingen 1993).
Freilich, diese beiden Darstellungen sind solche von Leuten, die energisch gegen einen Golfkrieg waren und genauso energisch unterstellen, daß dieser Krieg »von langer Hand geplant« gewesen sei. Über diese Behauptung werden uns einst die Archive der amerikanischen Regierung Auskunft geben, wenn die due procedure des Freedom of Information Act durchgegriffen haben wird. Für die Wahrnehmung des Krieges durch Deutschland geht es aber um etwas ganz anderes –
nämlich darum, ob in das Realitäts- und Selbstbewußtsein der deutschen politischen Apparate überhaupt die Anerkennung der Tatsache eingeflossen ist, daß dieser Krieg, dessen Entstehung im August 1990, zur selben Zeit, da Deutschland sich den Weg zu seiner Vereinigung freiarbeitete, subaltern von einem »Bündnispartner« hingenommen wurde, der sich zugleich von dessen Konsequenzen damals mit exorbitanten Geldsummen freikaufen zu können glaubte. Es spricht nicht für Gedächtnis
und Aufrichtigkeit der politischen Klasse in der zweiten Berliner Republik, wenn ein Untersuchungsausschuß des Bundestages sich bloß die Frage stellt, ob ein Waffenlieferungsgeschäft im Verlaufe des begonnenen Feldzuges gegen den Irak Rechtens oder eher eine Maßnahme korrupter Beteiligter war und ob der ehemalige Bundeskanzler daran seinen nicht so wohlriechenden Anteil gehabt haben könnte. Viel wichtiger wäre doch die öffentliche Erörterung der Frage, warum dieser frühere
Bundeskanzler nie in der Öffentlichkeit die Frage gestellt hat, ob der Golfkrieg Rechtens war und die von ihm geführte Bundesregierung richtig gehandelt hat, sich der Kriegführung seiner Bündnispartner wortlos unterzuordnen. Niemand würde wohl unterstellen, das Urteil des Bundeskanzlers a. D. hätte sich durch einen Essay Hans Magnus Enzenbergers im SPIEGEL vom 04.02.1991 beeinflussen lassen. Vielen anderen aber gab sein Aufsatz »Hitlers Wiedergänger - über Saddam Hussein im Spiegel der deutschen Geschichte« den Impuls, wie für Deutsche der Gang der Schlacht dort draußen im Osten zu fassen und zu begreifen sei. Diese Bespiegelung des Krieges, wie er in der alliierten Propaganda gegen Saddam Hussein geführt wurde und die irakische Nation unheilbar schlagen mußte, für der deutschen
Sprache mächtige Leser war, so treffend auch immer, im ganzen verstanden eine Eulenspiegelei. Das kann er eben, der sprachgewandte »Harlekin« des geschichtlichen Situationismus, wie ihm vor Zeiten einmal in einem lichten Moment Jürgen Habermas knurrend bescheinigte. Man kann Enzensberger auch bescheinigen, daß er in diesem Essay mit messerscharfer Ambivalenz auch den »Schurken« porträtiert hat, den alle Doktrinen der Sicherheit sich seither zum Feind erkoren und
demzufolge den »Schurkenstaat« als Wiedergänger des Gegners im kalten Krieg ausfindig gemacht haben. Was rät sich einer Nation, die nun in einem solchen Aufsatz dargetan bekommt, daß sich der »Todesrausch« eines Hitler »und seiner Anhänger« im Irak des Saddam Hussein als Wiederkunft niedergeschlagen hat und das Sehnen nach Untergang, obwohl Enzensberger das als selbstverständlich gar nicht eigens ausspricht, ganz sicher in der »Operation
Wüstensturm« auftragsgemäß sein Ende finden wird? Wenn das sowieso als die zwingende Folge dieses Todesrausches vorauszusetzen ist, welches Urteil kann sich die soeben neuerstandene gesamtdeutsche Nation über diesen Krieg bilden, ohne nicht sogleich um ihren Lebensmut fürchten zu müssen? Wer sich von solcher situationistischer Deutung in Bann halten läßt und sich weder – in Wiedergängers Weise – in die Haut der Iraker noch auch an die der Seite derer, die das
irakische Volk mit ihren Bomben strafen wie die Alliierten einst das deutsche Volk, versetzen will, findet keine Möglichkeit zur Reflexion, sondern nur noch zu einem Reflex: dem Totstellreflex. Vielleicht war das der beste Rat, den Enzensberger damals seinen Lesern aufnötigen konnte. Eine Ermunterung zum souveränen Gebrauch der Vernunft war der ganze Aufsatz aber mit Sicherheit nicht. Das kann selbst der blitzgescheiteste
situationistische Deutungsversuch auch gar nicht leisten. Ganz besonders dann nicht, wenn in den entsprechenden Erläuterungen nur die kollektiven Kränkungen und deren Wirkungen auf das Selbstwertgefühl angeführt werden, wobei dabei sowohl vergessen wird, daß es bei Kränkungen nicht nur um ein »Wertgefühl«, und umgekehrt nicht allein um ein Erleiden, sondern um eine Aktion des Verletzens geht. Auch die Verwirrung bis hin zum Totstellreflex, die Enzensberger in
seinem Situationismus mitproduzierte, hat immer eine Vorgeschichte. Was in eine solche Überlebensfalle führen kann, in denen die Wiedergänger mit einem Mal als Feinde des Menschengeschlechts auf die Bühne der Geschichte treten können, hat Dietrich Bonhoeffer 1941 kurz und knapp so zusammengefaßt: »Realismus verlangt, daß die Welt vor einer Wiederholung des Nationalsozialismus geschützt werden muß, aber derselbe
Realismus verlangt auch, daß wir die Welt vor einer Wiederholung des psychologischen Prozesses schützen müssen, der sich zwischen 1918 und 1933 in Deutschland vollzog. Der Wagen von Compiegne ist geradezu das Symbol für diese Tarnung der Ungerechtigkeit. Es ist eine gerade ausreichende, relative Rechtfertigung für einige der Ansprüche Deutschlands, um Hitler die Möglichkeit zu geben, sich als ein Prophet einzuführen, der gekommen war, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das ist
die Hauptquelle der gegenwärtigen moralischen Verwirrung.«
Transatlantische Konflikte?
Sollte überhaupt je die verantwortliche Politik im ersten Jahr nach der Neuvereinigung bei ihrem Verhalten gegenüber dem Golfkrieg einen Konflikt wahrgenommen haben, so ist seither in der Öffentlichkeit darüber nichts ruchbar geworden. Die »Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes
1989/1990«, mit denen der frühere Bundeskanzler vor zwei Jahren seiner Aussicht auf Wiederwahl Auftrieb und den Zeitgeschichtsschreibern Stoff geben wollte, vermitteln uns darüber wenig Aufschluß. Wobei natürlich in Rechnung zu stellen ist, daß ein Mann wie der frühere Bundeskanzler über ein so umfangreiches Verdrängungsvermögen verfügte und verfügt, daß er mit diesem Vermögen spielend genauso viele Entscheidungen in der Weltpolitik vermeiden konnte, wie er mit
dem Vermögen der Bundesrepublik Deutschland Ziele erwerben konnte. Indessen wäre die Betätigung des Erinnerungsvermögens in Deutschland zu dieser Situation nicht gerade müßig, auch um sich vor falschen Frontstellungen zu hüten, die etwa feinfühlige Leute, die ihren Protest gegen den Golfkrieg 1990/1991 lautstark angemeldet haben, in einer Weise einnehmen könnten, daß sie dem Organisator des Golfkrieges Powell bis
heute nicht verzeihen, daß auch sie in jener Zeit zum Totstellen verhalten worden sind. Diesen Leuten kann es nützen, wenn sie sich in Woodwards »Befehlshaber« darüber unterrichten, bei wem die letzte Verantwortung für die Entscheidung zu diesem Krieg bis heute liegt. Wenn die Rolle des Generals Powell bei der Bildung dieser Entscheidung von Woodward richtig überliefert ist ( – was trotz Woodwards mit »All the President`s Men« erworbenen Rufes nicht ganz unzweifelhaft ist, weil er
eben Reporter und oft Spielball seiner Quellen ist, wie vor allem die Nicht-Hinterlassenschaft von »Deep Throat« zeigt – ), dann muß man zumindest die Möglichkeit unterstellen, daß der Economist nicht falsch liegt und aus britischer Sicht zu Recht anmahnt, daß es das außenpolitische Duo von Präsident George Bush II verdient, mit vorsichtigem Respekt behandelt zu werden, statt es wie bisher mit Hallelujas zu begrüßen. Aus deutscher Sicht wiederum kann das heißen, daß man Powell
nicht mit Nelson Mandela und Condoleezza Rice nicht mit Jeanne d`Arc verwechseln muß, um solchen ersten Ernennungen mit verhalten zuversichtlichem Respekt zu begegnen. Der Koordinator für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit konnte vor einem Jahr in seiner Rede die transatlantischen Konflikte nicht übergehen; er könnte es auch heute nicht. Deren einen, äußerst wichtigen, den des Vorgehens innerhalb der internationalen Staatenwelt, ( - die
immerhin mit der Charta der Vereinten Nationen eine Satzung besitzt, gegen deren gültiges Recht Europa und Amerika als NATO im vergangenen Jahr zusammen einen Krieg begonnen haben - ), faßt Karsten Voigt so zusammen: »Eine grundsätzliche transatlantische Differenz besteht allerdings im Grundprinzip, nach dem Amerika bzw. Europa ihre internationalen Beziehungen definieren - multilateral, isolationistisch oder unilateral. Im Rahmen dieser Modelle findet in
den USA derzeit eine außenpolitische Diskussion statt, die eine historische Debatte zwischen alten außenpolitischen Schulen erneut aufgreift: zwischen den Anhängern Hamiltons, Jeffersons und Jacksons.« Welche bedenklichen Folgen das häufig wiederkehrende Obsiegen der interventionistischen und unilateralen Schule haben kann, erläutert der Koordinator in seinem Vortrag so: »Klar ist, dass das Ziel außenpolitischen Handelns der USA immer
die weltweite Durchsetzung amerikanischer Werte und Interessen bleibt. Die außenpolitische Vorgehensweise, mit der dieses Ziel erreicht wird, ist dabei variabel. In der amerikanischen Außenpolitik hat deshalb eine Mischung aus selektivem Multilateralismus und gelegentlicher Neigung zu unilateralem Handeln an Boden gewonnen. Das Leitmotiv lautet: "America first". Vorrangig die USA selbst entscheiden darüber, wann, mit welchen Mitteln und mit Hilfe welcher Institutionen von den USA
selbst definierten Werten und Interessen mit universalem Anspruch zu universalem Durchbruch verholfen wird. Dieser Ansatz findet insbesondere in Kreisen seine Unterstützung, die der republikanischen Partei angehören, gelegentlich auch bei Mitgliedern der Demokraten. Er ist nicht unbedingt inneramerikanischer Konsens, denn auch in Amerika gibt es überzeugte Befürworter des Multilateralismus. Aber die
Auffassung, dass Amerika, wenn es die nationalen Interessen erfordern, legitimerweise seine Macht auch ohne Unterstützung oder gar ohne Zustimmung seiner Partner einsetzen kann, hat nach 1989 mehr Anhänger gewonnen. Das Bewusstsein einzigartiger moralischer und militärischer Überlegenheit verstärkt diesen Reflex. In Europa hat sich dagegen - seit 1945 - der Multilateralismus als bevorzugte außenpolitische Handlungsform durchgesetzt.
Besonders deutlich kommt das im europäischen Integrationsprozess und der Einstellung der Europäer zu kollektiver Sicherheit und Verteidigung zum Ausdruck. Das gilt insbesondere auch für Deutschland, das auf Grund seiner Geschichte und geographischen Lage den Multilateralismus zur unverzichtbaren außenpolitischen Norm erhoben hat. Europa hat aus seiner Geschichte die Lehre gezogen, dass nur die multilaterale Einbindung von Macht und die multilaterale
Kanalisierung von Interessenkonflikten zwischen Staaten zu dauerhafter regionaler Stabilität führen und allen beteiligten Staaten ein echtes Gefühl der Sicherheit verschaffen kann.« Dieser »Multilateralismus« kann sich auf einen hervorragenden amerikanischen Denker, Forscher und Präsidenten berufen, den Karsten Voigt in seiner Aufzählung der Schulen aus unerfindlichen Gründen vergessen hat, auf John Quincy Adams.
Der hat nicht nur über das Verhältnis der jungen Vereinigten Staaten zu anderen Staaten sehr viel nachgedacht und geschrieben. Er hat dieses Verhältnis auch über Jahrzehnte, selbst über seinen Tod hinaus geprägt. In einer Gedenkrede zum 4. Juli 1821 sagte Adams einmal, daß nur dann ein Krieg gerechtfertigt wäre, wenn die Rechte oder die Sicherheit der eigenen Nation direkt bedroht würden, und fuhr fort: »Wherever the standard of freedom and Independence has been
or shall be unfurled, ... there will be her heart, her benedictions and her prayers be.
But she goes not abroad, in search of monsters to destroy. She is the well-wisher to the freedom and independence of all. She is the champion and vindicator only of her own. She well knows that by once enlisting under other banners than her own, were they even the banners of foreign independence, she would involve herself beyond the powers of extrication, in all the wars of interest and
intrigue, of individual avarice, envy, and ambition, which assume the colors and usurp the standard of freedom.« Dies heißt unter anderem im Klartext, daß Amerika wohl bis zu einem weiten Grade Anteil nehmen kann am Kampf um Freiheit überall auf der Welt, daß seine Aufgabe aber nicht sein kann, andere Nationen mit Waffengewalt zu befreien. Keiner weiß das besser als der Sohn des amerikanischen Erfolges der
Selbst-Befreiung. Und die 1945 befreiten Deutschen und ihre Nachfahren von heute sind nur dann nicht lediglich besiegt worden, wenn sie sich dieses Selbstgefühl, das »amerikanische Selbstgefühl« anverwandeln können und wenn das »Aussprechen dessen, was ist« (Rosa Luxemburg) es ihnen auch einmal gegenüber einer amerikanischen Regierung gebietet, dieses Selbstgefühl zur Geltung zu bringen. Die Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland und der
Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht nur die Zusammenarbeit von Staaten, sondern eine Freundschaft auf der Grundlage von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück aller Teilhaber ihrer Gemeinwesen. Das gilt auch, wenn der neue Präsident der Vereinigten Staaten George W. Bush heißt und der zweite Sohn eines Präsidenten ist, der auch selbst Präsident wird - ebenso unter turbulenten und von beispiellosem Streit begleiteten
Umständen, die im Jahr 2000 die Institutionen der amerikanischen Verfassung mit auseinander- und gegeneinanderstrebenden Gewichten zu belasten drohen wie 1824 bei der Ausnahmewahl des Präsidenten Adams durch den Kongreß. Ängstlichen Gemütern kommen da in den USA schon Hintergedanken an Dynastie, wenn sie an die hintergründige, hartnäckige und kostspielige Betreibung der Kandidatur des Sohnes durch den gegen William Jefferson Clinton unterlegenen
Vater Bush denken. Das ist selbstredend abwegig. Es gibt neben der geschichtlichen Tatsache, daß hier ein Sohn eines Präsidenten auch Präsident wird, noch eine andere, möglicherweise bedeutsame Gemeinsamkeit zwischen George W. Bush und John Q. Adams: Beide haben selbst nahezu nichts unternommen, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Worin gerade wegen dieser Gemeinsamkeit gleichwohl die Unterschiede zwischen beiden liegen werden, werden wir
genauer beurteilen können, wenn wir am Beginn dieser Amtsperiode uns darüber vergewissern, welchen Verlauf und welchen Ausgang die Präsidentschaft John Quincy Adams` genommen hat, über die in der Biographie des lebenslang hervorragenden Präsidentensohnes Adams von Lynn Hudson Parsons lehrreiche Einsichten zu gewinnen sind. Über John Quincy Adams: Liberty is Power 
|